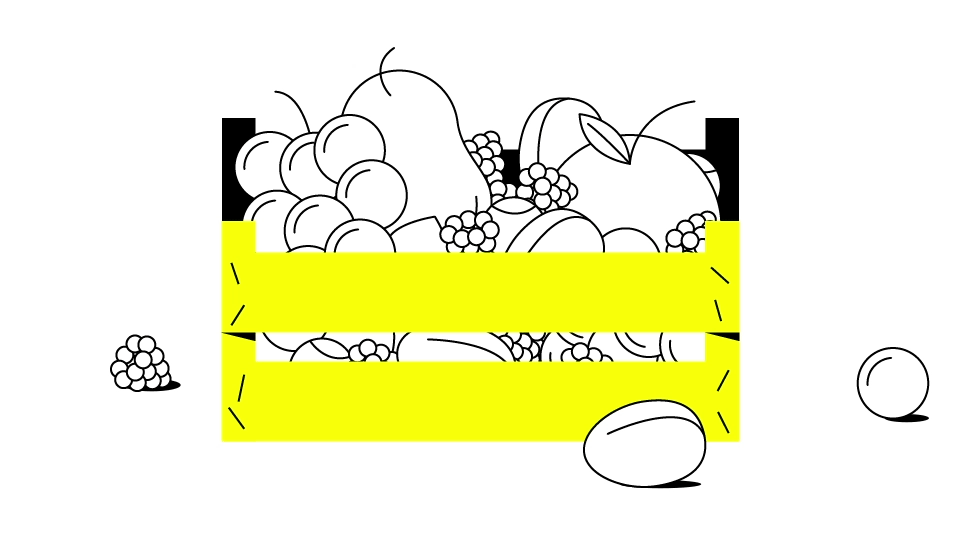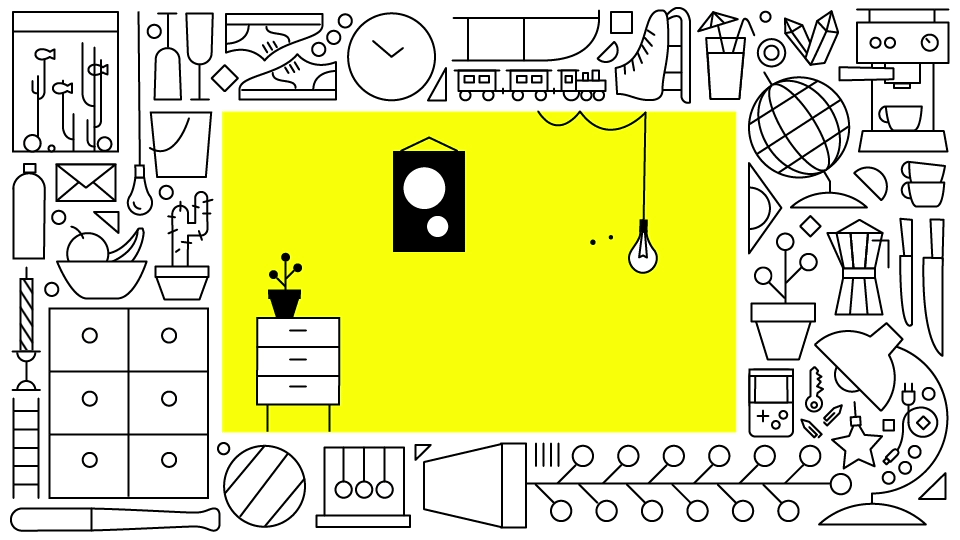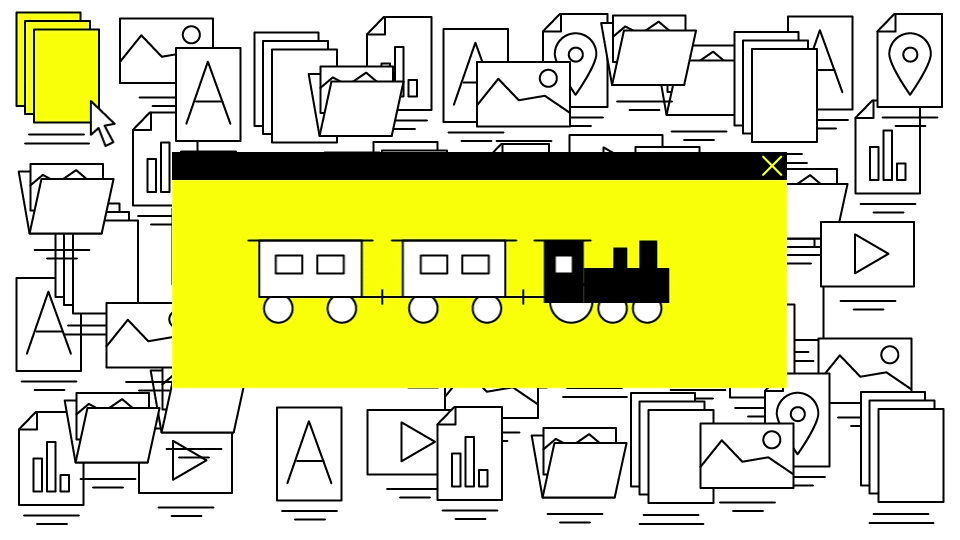Oliver Herwig • 18.09.2018
Sucht und Ordnung
Besitz belastet, heisst die Diagnose von Soziologen und Psychotherapeuten. Doch was können wir tun, wenn sich immer mehr Dinge ansammeln? Ein Streifzug durch Unterbettkommoden und Bundesordner, Aufräumhelfer und Self-Storage-Einheiten. Über den Sinn von Ordnungssystemen.
In der Garage lagern Ski ohne Bindung, daneben stapeln sich Töpfe mit halbleerer Wandfarbe und Zeitschriften. Im Keller verstauben Omas Einweckgläser, Staubsaugerbeutel und ausgediente elektrische Zahnbürsten, und im Schrank lauern Weihnachtskugeln, Deko und Lametta, ausreichend für fünf bis sieben strahlende Weihnachtsbäume. Das muss nicht krankhaft sein, das ist höchstens bedenklich. Allein in Deutschland leiden geschätzt 1,8 Millionen Menschen am Messie-Syndrom, wie das «Ärzteblatt» im September 2002 berichtete. Ihr Alltag werde von Desorganisation beherrscht, durch ein «inneres Chaos, das sich nach aussen zeige.» Klingt nach verirrten Jägern und Sammlern. Der Hang, Dinge zu horten, hat früher geholfen, durch widrige Zeiten zu kommen und das aufzubauen, was wir Zivilisation nennen. Nun sind die Dinge des Lebens zum Problem geworden. Es gibt einfach so viel davon. Also heisst es Ordnung halten. Für jede Zahnbürste gibt es einen Wandhalter, für jeden Schraubenschlüssel den passenden Einsatz im Koffer, der wiederum genau in die Nische im Werkzeugschrank passt.
Ordnung ist Arbeit, sie wird ja schliesslich nicht gesessen oder gelegen, sondern gehalten. Wir alle kämpfen mit den Hamstern in uns. Schon Designlegende Dieter Rams riet seinen Adepten, das Chaos um sie herum zu lichten. Denn wir sammeln immer mehr Zeugs an, oft ohne Sinn. Es gibt Wohnungen, durch die ihre Bewohner nur durch Trampelpfade gehen, eingeklemmt zwischen Dingen, die sie ja vielleicht mal brauchen könnten. Wir alle sind vom Ansammeln betroffen. Wer mit 20 mit dem Fahrrad umgezogen ist oder mit dem Kombi, braucht zehn Jahre später garantiert einen Möbelwagen und weitere zehn Jahre später ein Team von Profis, die zerbrechliches Porzellan in Seidenpapier schlagen und bei jeder Treppenstufe über das Klavier fluchen, auf dem seit Jahren niemand mehr gespielt hat.
Es scheint ein Grundgesetz zu geben: Dinge ziehen mehr Dinge nach sich.
Ein Füller braucht Patronen oder ein Tintenfass, früher noch Löschpapier und selbstverständlich ein Etui. Das Handy wiederum braucht Hülle, Powerbank und Kopfhörer. Und wenn doch mal was wegfällt durch eine technische Neuerung – das Ladekabel zum Beispiel –, kommen die Funktionen über die Hintertür wieder zurück, als kabellose Ladestation etwa.
Die Dinge des Lebens
«Exzess und Überfluss sind relativ. Es gibt keine fixe Trennlinie zwischen Bedürfnissen und Wünschen.»
Die Akkumulation von Gegenständen ist relativ neu in der Menschheitsgeschichte. Wer alte Bauernhäuser besucht, findet im Flur oft nur eine Nische. Dort lagen die wichtigsten Güter. Kein Regal, kein Speicher. Das Loch in der Wand reichte für Schlüssel und Petroleumlampe. Für die Kleidung gab es Haken, wer reich war, konnte sich sogar Truhen leisten. Vor gerade mal 100 Jahren zählte ein Haushalt vielleicht 200 Dinge. Inzwischen sind es 50 Mal so viel – rund 10.000 Gegenstände. Und doch haben viele Dinge nicht mehr den Stellenwert wie früher. Das Sonntagsgeschirr wurde in Anrichten regelrecht präsentiert, um Kultur, vor allem aber den gesellschaftlichen Status der Gastgeber zu zeigen. Dann kam die Schrankwand mit Ablagen für dies und das. Heute reicht ein Plasmabildschirm, halb so breit wie die Wand. Das hat den Vorteil, dass man auch die letzten Bücher zusammenkehren und digitalisieren kann. Dinge sind selbstverständlich geworden. Man hat sie halt. Oder eben nicht mehr (sichtbar). Doch wir können noch so sehr teilen und entrümpeln, ohne Ordnung geht es nicht. Sichtbares Chaos erzeugt jedoch manchmal auch das Gegenteil – spartanische Wohnlandschaften. Je mehr Messies und Prepper (die palettenweise Corned Beef, Bohnen und Reis einlagern, dazu Batterien, Funkgeräte, Schutzwesten und Werkzeuge, um für die grosse Katastrophe gerüstet zu sein), desto mehr organisierte Wohnasketen und Ordnungsfanatiker.
Doch nochmals zurück zum Überfluss, der nicht zuletzt einer ausdifferenzierten Gesellschaft und einer hochgerüsteten Industrie entspringt, die für jede Sportart die richtige Kleidung entwickelt. Da gibt es das Leibchen fürs Fitness-Studio, fürs Radeln, fürs Yoga und noch eins für Pilates. Am eigenen Leib erfahren wir eine Explosion der Gerätschaften. Und im Automobil, abzulesen an immer gewichtigeren Modellen. Der Golf von 1974 brachte rund 750 Kilogramm auf die Waage, heute sind es annähernd anderthalb Tonnen. «Herrschaft der Dinge» nennt das Frank Trentmann, der als Professor für Geschichte am Birbeck College der Universität London lehrt. Der Alltags- und Konsumforscher meint: «Exzess und Überfluss sind relativ. Es gibt keine fixe Trennlinie zwischen Bedürfnissen und Wünschen.» Erst kommt das Fressen, dann die Tiffany-Lampe, könnte man die Maslowsche Bedürfnishierarchie (Bedürfnispyramide) abkürzen, die der Psychologe 1943 publizierte. «Wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, so entsteht ein anderes», schrieb Abraham Maslow. Häufen wir auch deshalb Dinge an, die uns das Leben erleichtern sollen und dann wie Treibsand ganze Wohnungen überschwemmen? Diese Flut wieder in den Griff zu kriegen, wird zu einer echten Herausforderung.
Leben und lagern lassen
Wenn eine Wohnung überquoll, sperrte er sie einfach ab und bezog eine neue.
Zum Glück gibt es Self-Storage. Wieder ein Wort, dass ziemlich gut beschreibt, wie wir heute leben und lagern lassen. Wir packen unser Zeugs einfach weg und mieten Boxen am Stadtrand. Aus den Augen, aus dem Sinn. Von einem bis zu 100 Quadratmetern reicht das Angebot der externen Lager, die Einheiten sind bis zu drei Meter hoch. Profis haben eine Faustregel: Zehn bis 15 Prozent der Wohnungsgrösse muss ein Lager haben. Das ist, als ob man all die Luft zwischen den Dingen entweichen lässt und Kiste auf Stuhl auf Sofa bis unter die Decke stapelt. 100 Quadratmeter Wohnung werden so auf zehn bis 15 Quadratmeter Lager eingedampft. Lohnt sich das überhaupt? Auf dem Land vielleicht nicht, aber in den Städten, in denen Wohnungen mit Speisekammer und grossem Keller Mangelware sind, nutzen viele ein externes Lager als «verlängertes Wohnzimmer», zitiert der MDR den Vorstandsvorsitzenden des Verbands Deutscher Self Storage Unternehmen e.V. (VdS), Christian Lohmann. Selbstlagerboxen finden sich an grossen Ausfallstrassen und sind so eingerichtet, dass man anruft, mit dem Wagen vorfährt, den Vertrag unterschreibt und noch am selben Tag einlagert. Mit eigenem Zugangscode und Chipkarte sind die Lager rund um die Uhr geöffnet. Start-Ups bieten sogar einen Rundumservice und holen die Kisten Zuhause ab. Als Erinnerung an all die Dinge, die da aus dem Blickfeld verschwinden, bieten die Anbieter Apps an, in die man seine Habseligkeiten als Fotos hochladen kann. Vielleicht könnte man gleich noch ein Fotobuch daraus machen, doch wohin damit?
Kritiker werden einwenden, dass hier ein cleveres Geschäftsmodell Geld aus unserem Hang zum Horten macht. Doch hängt das ganz von der Perspektive ab. Wer eigentlich umziehen müsste, weil er die Skiausrüstung nicht auch noch in den Kleiderschrank stellen will, findet im Self-Storage eine clevere Alternative, wer allerdings Dinge ansammelt und ansammelt, verlagert nur das Problem. Doch keine Angst. Wir sind in guter Gesellschaft. Angeblich war auch Picasso an passionierter (An)Sammler. Wenn eine Wohnung überquoll, sperrte er sie einfach ab und bezog eine neue. Das ist, zugegeben, eine Luxus-Lösung.
Wer nach diversen Entrümpelaktionen immer noch zu viel Zeugs hat, das herrenlos durch die Wohnung flattert, sollte – paradoxerweise – shoppen gehen und Neues kaufen. Ordnungssysteme nämlich. Onlineshops und Einrichtungshäuser springen jedenfalls auf den Zug auf: Es gibt Boxen, Garderoben, Kleiderständer, Körbe, Regale, Schirmständer, Schlüsselkästen, Schuhregale, Truhen, Unterbettkommoden und Zeitungsständer. Es gibt leider keine Statistiken, wie gross das Verhältnis der kleinen Helferlein zu den Dingen ist, die sie sortieren sollen, geschätzt dürfte hier ein Ordnungssystem für Dutzende Dinge herhalten. Ungeschlagen ist natürlich der «Bundesordner» –Decke und Rücken marmorpapierkaschiert, Unterkanten, Ecken und Griffloch stahlblechverstärkt, Hebelmechanik aus Metall. Samt Rückenschild und Panzerrand – ein Inbegriff der Verdichtung durch Ordnung.
Alles in Ordnung?
«Nichts zu bedürfen ist göttlich, möglichst wenig zu bedürfen, kommt der göttlichen Vollkommenheit am nächsten.»
Was also sagt das Sammeln, Aufbewahren und platzsparende Lagern über unsere Gesellschaft aus? Vor allem, dass wir uns im Umbruch befinden. Wir beanspruchen mehr Ressourcen, Platz und Energie als Generationen vor uns – und stossen langsam an die Grenzen des Möglichen. Wohnungen wachsen nicht mehr mit. Mit Blick auf Metropolen wie Tokyo, London, Zürich und München liegt die Vermutung nahe, dass das Lagern nicht nur ein Ausdruck des Überflusses ist, sondern auch eine Notwendigkeit, will man auf möglichst wenig Raum sein Hab und Gut verstauen. Dabei haben sich die gesellschaftlichen Codes verändert. Was uns als zu viel vorkommt, kann in anderen Kulturkreisen Ausdruck von Reichtum und gesellschaftlicher Stellung sein. In Indien trägt man seinen Status am Handgelenk, in Form von Goldketten. Wir haben dafür Handys mit exotischen Urlaubsfotos, Funktionsklamotten und manchmal sogar noch Autos.
Seit geraumer Zeit formiert sich eine Gegenbewegung zum masslosen Konsum. Weniger, dafür bewusster. Teilen statt kaufen. Entschlacken und zu sich finden, zu den eigenen, verschütteten Bedürfnissen. So lauten einige Thesen. Dabei propagierte schon Sokrates: «Nichts zu bedürfen ist göttlich, möglichst wenig zu bedürfen, kommt der göttlichen Vollkommenheit am nächsten.» 2.400 Jahre später machten Werner Tiki Küstenmacher und Lothar J. Seiwert daraus den Bestseller «simplify your life – einfacher und glücklicher leben» und lancierten ein kleines Vereinfachungsuniversum aus Büchern, Kalendern und Lebenshilfe. Das Unbehagliche daran? Selbst das Einfache drängt nach Entfaltung und – man muss es leider sagen: zu Unübersichtlichkeit. Es ist noch nicht ausgemacht, wohin die «Herrschaft der Dinge» wirklich führt. Wer nicht zu Dystopien neigt, muss sich zwangsläufig beschränken. Bürowelten machen es vor – Konzepte wie die «Clean Desk Policy» sorgen für brutale Ordnung. Wer sich einen Schreibtisch teilt, oder gar keinen eigenen mehr hat, ist darauf angewiesen, dass jeder am Abend all die Blöcke, Stifte und Notizen fein säuberlich aufräumt und die Arbeitsfläche ordentlich aufgeräumt übergibt. Simplify your work gilt auch für unser Leben. Wir kommen nicht rum ums Entrümpeln, Entschlacken, Abgeben und Teilen. Und wenn gar nichts mehr geht, gibt es ja noch Lösungen, um unseren wachsenden Überfluss zu entsorgen: Tüten und Zugbandbeutel, Altglas-Container und Mülltonnen
Illustration: Josh Schaub