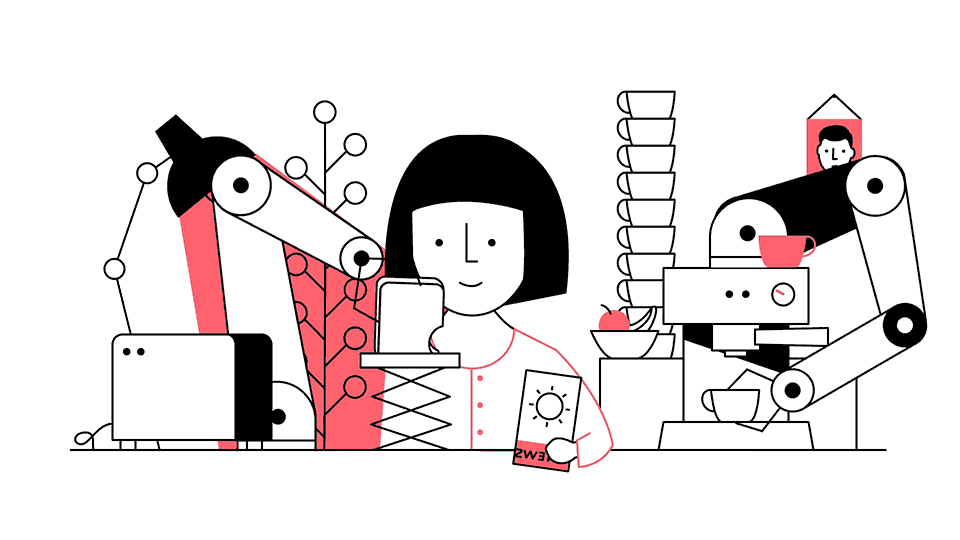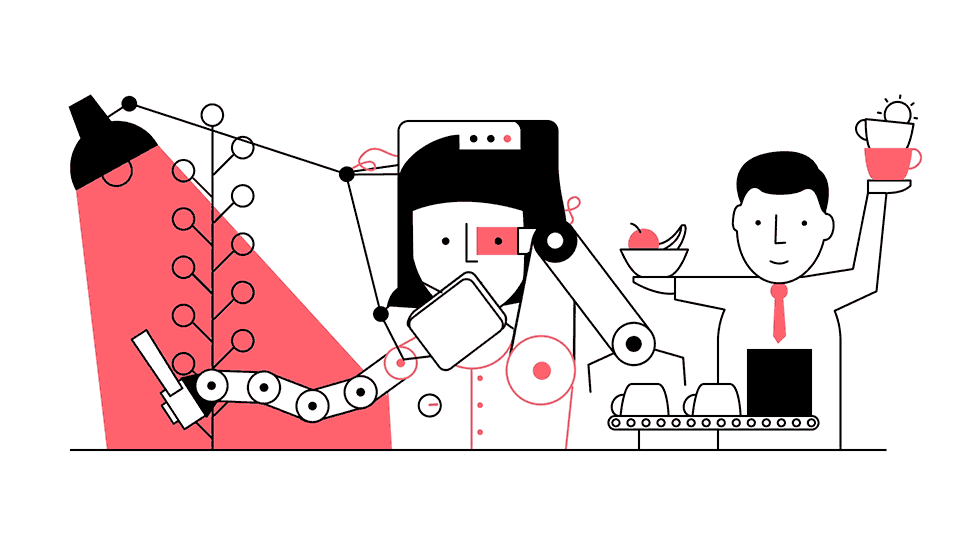Andrea Wiegelmann • 21.03.2018
Dein neuer
Mitbewohner
Roboter sind, ebenso wie intelligente Steuerungssysteme, heute unverzichtbarer Bestandteil unseres Alltags. Während wir sie selbstverständlich nutzen, scheuen wir davor zurück, dieses Verhältnis zu definieren. Dieses Vakuum sollten wir füllen, wenn wir unsere Zukunft mit den Maschinen aktiv gestalten wollen.
In dem 1982 erschienen Science-Fiction-Film Blade Runner des US-amerikanischen Regisseurs Ridley Scott rettet der humanoide Roboter Roy (im Film als «Replikant» bezeichnet) der Hauptfigur Deckhard, gespielt von Harrison Ford, angesichts seines eigenen «Todes» das Leben, obwohl Roy Deckhard zunächst töten wollte. In Blade Runner sind die den Menschen täuschend ähnlich aussehenden Roboter mit einem Gedächtnis ausgestattet, das es ihnen erlaubt, sich zu erinnern und das eigene Handeln zu hinterfragen. Sie sind lernfähig und kommen dem Menschen in ihren Verhaltensmustern nahe. Die Roboter gehören im Film der alles beherrschenden Tyrell Corporation, einem Hightech-Konzern, der sich auf die Herstellung und Verwaltung seiner Androiden spezialisiert hat.
Die beschriebene Szene stellt die zentrale Frage, die von Anfang an die Handlung begleitet: Was macht uns Menschen zu Menschen und was unterscheidet uns von den Apparaturen, gerade wenn sie beginnen, uns zu gleichen, und wir emotionale Beziehungen zu ihnen aufbauen? Tönte die Frage 1982 noch nach Zukunftsmusik –wenn sie auch immer wieder in Literatur und Film thematisiert wurde – so sind wir inzwischen durch humanoide Roboter in Haushalt und Pflege unmittelbar mit ihr konfrontiert. Dabei ist unser Verhältnis zu ihnen ambivalent und die Skepsis gegenüber ihrem Einsatz gross.
Interessant ist dabei, dass unser Unbehagen gegenüber der Möglichkeit, mit einem Roboter zu leben, nichts mit dessen technischer Infrastruktur zu tun hat, die das eigentlich Bedenkliche sein könnte, wenn es etwa um die Auswertung und Nutzung unserer persönlichen Daten geht. Doch ob Smartphone, Steuerungssysteme in Gebäuden oder Softbots, die uns Einkaufstipps geben, künstliche Intelligenz nutzen wir bereitwillig. Dank «Alexa», «Google Home» & Co. haben intelligente Systeme zudem längst Einzug in unser privates Umfeld erhalten. Der Schritt zum persönlichen Roboter müsste also kein grosser sein.
Dennoch, in dem Moment, wenn der computergesteuerte Apparat eine Form erhält, die ihn als «Gegenüber» erscheinen lässt, reagieren wir emotional. Doch letztlich passiert uns das auch bei unserem Laptop, wenn es wieder einmal abgestürzt ist oder beim Smartphone, wenn es gerade dann die App nicht öffnet, die man dringend braucht. Was also macht dieses diffuse Unbehagen aus? Der Zukunftsforscher und Cyperpunk-Autor Bruce Sterling erklärt dazu, dass der Begriff Roboter von dem tschechischen Autor Karel Čapek geprägt wurde. Čapek schrieb 1920 ein Theaterstück, in dem roboterhafte Arbeiter (tschechisch «robota», was so viel bedeutet wie Zwangsarbeiter) die Menschheit ausrotten. Die paranoide Angst, die Maschine könnte sich gegen uns wenden, schwingt scheinbar in der Auseinandersetzung mit Robotern immer mit. In Blade Runner sind die «Replikanten» mit einer Lebenszeit von vier Jahren ausgestattet, um für die Menschen nicht zur Gefahr zu werden. Die Frage nach «gut oder böse» erklärt unser ambivalentes Verhältnis zu den Apparaturen.
Der Automat, dein persönlicher Assistent
Verständlich wird dies, wenn die Maschine als Ersatz für den menschlichen Kontakt oder Austausch funktionieren kann, so wie «Alice». «Alice» hat ein hübsches Puppengesicht und sieht ein bisschen aus wie die Vergrösserung einer weiblichen Playmobilfigur. Doch der Roboter ist kein Spielzeug, er unterstützt seine älteren Mitbewohner im Alltag, schaut mit ihnen fern und kontrolliert die morgendliche Tabletteneinnahme. Die Dokumentation von 2015 Alice Cares (Ik ben Alice) der Regisseurin Sandra Bruger zeigt, wie alleinstehende ältere Damen durch den Einsatz des emotional intelligenten Roboters in ihrem Alltag interagieren und aktiver werden. Menschliche Betreuung wäre sicher wünschenswerter, doch was, wenn wir nicht mehr genug sind, um das zu leisten?
Während wir in Mitteleuropa noch am Anfang dieser Entwicklung stehen, gehört der Einsatz humanoider Roboter in der häuslichen und stationären Pflege in Japan zum Alltag. Dass die Technikbegeisterung der Japaner diese Entwicklung befördert hat, darf dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie zudem eine schlichte Notwendigkeit ist. Bereits 2030 wird ein Drittel der japanischen Bevölkerung über 64 Jahre alt sein. In Europa sieht es nicht besser aus: Von den 20 Staaten mit dem weltweit höchsten Anteil an über 64-jährigen in der Gesamtbevölkerung gehören bis auf Japan alle zur Europäischen Union. Man kann sich leicht ausrechnen, dass die Zahl allein lebender und pflegebedürftiger älterer Menschen und auch Kranker demnächst die Zahl der möglichen Betreuer bei weitem übersteigen wird.
Heute gibt es zwei Arten von Robotern in der Pflege: Jene, die den Alltag des Pflegepersonals erleichtern, die Patienten transportieren oder die Pflegenden in der Verrichtung alltäglicher Dinge unterstützen. Der «Care Assist Robot» ist ein solcher Serviceroboter, der an Apparaturen aus der Fertigungsindustrie erinnert, ebenso «Hospi». So wie bei «Alice» setzen andere Designs auf unsere Empathie. Etwa der zu therapeutischen Zwecken eingesetzte Roboter «Pari», der einem Sattelrobbenjungen nachempfunden ist. Seine Entwicklung basiert auf der guten Erfahrung in tiergestützten Therapien. Bei «Paro» ist der positive Effekt auf die geistige und körperliche Beweglichkeit älterer Menschen nachgewiesen, er kommt inzwischen in 30 Ländern zum Einsatz, darunter auch in Deutschland.
Auch für den privaten Haushalt gibt es Modelle wie etwa «Zeno» oder «Pepper». Letzterer ist so programmiert, dass er 20 Sprachen sprechen, unsere Emotionen anhand unserer Mimik und Stimme erkennen und entsprechend reagieren kann. Kuscheln und streiten wir also zukünftig mit unserem Roboter, wohl wissend, dass es eine Maschine ist?
In allen geschilderten Beispielen bleibt die maschinelle, zumindest künstliche Natur des Roboters erlebbar. Dies liegt auch daran, dass ein dem Menschen ähnliches Design von uns als unheimlich empfunden wird. Dieses Phänomen hat der japanische Robotiker Masahiro Mori bereits 1970 als «Uncanny Valley» beschrieben. Gleichzeitig schreiben wir ansprechend gestalteten Robotern menschenähnliche Eigenschaften zu, und letztlich ist es diese Zuschreibung, die unsere Beziehung zu ihnen prägt.
Dein Freund und Helfer?
Diesem Thema widmet sich auch die 2012 von Jake Schreier realisierte Komödie Robot&Frank, die in einer «nahen Zukunft» spielt und sich von unserem Heute frappierend wenig unterscheidet. Der Film erzählt die ambivalente Beziehung zwischen dem ehemaligen Juwelendieb Frank, der an beginnender Demenz leidet, und seinem Pflegeroboter. Die Maschine übernimmt, nachdem Frank sie zunächst ablehnt, die Rolle eines guten Freundes.
Die Roboter, das zeigt der Film einmal mehr, werden von uns trotz aller Bedenken auch akzeptiert. Aber heisst das, dass wir ihnen vertrauen? Lassen wir sie für uns entscheiden: was wir essen, was wir anziehen, welche Medikamente wir nehmen? Und weitergedacht, wenn wir sie Handlungen ausführen oder Entscheide fällen lassen und Aufgaben an sie delegieren, sind die Maschinen dann auch für Fehler verantwortlich? Müssten sie dann nicht so programmiert sein, dass sie lernen können, in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln wie Roy in Blade Runner? Und wann ist dann der Punkt erreicht, wo man sie als Existenz auch achten müsste?
Wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen. Die «nahe Zukunft» steht vor der Tür, und wir sollten sie gestalten. Mit künstlicher Intelligenz ausgestattete, digitale Assistenten für den privaten Bereich und zur kommerzielle Nutzung sind der Trend in der Technologieindustrie. Ein weiterer Trend sind intelligente Prothesen und Implantate in unserem Körper. Was Ridley Scott in Blade Runner als dystopisches Zukunftsszenario aufgezeigt hat, wird mehr und mehr zur Realität. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verwischen zunehmend.
Neuentwicklungen und Produkte stammen dabei in der Regel aus der Hand grosser Technologiekonzerne. Ihre künstlichen Intelligenzen sammeln Daten über uns, unsere Gewohnheiten, unser Verhalten. Google, Amazon & Co. können diese Daten auswerten und nutzen – und das tun sie auch, heute und mehr noch in Zukunft. Die Grenzen zwischen Fürsorge, Unterstützung und Überwachung sind fliessend. Es ist also nicht die Frage, ob wir Roboter brauchen – denn sie sind längst unverzichtbarer Teil unseres Alltags – sondern wie wir unser Verhältnis zu ihnen und den Organisationen und Infrastrukturen definieren, die dahinterstehen.
Illustrationen: Josh Schaub